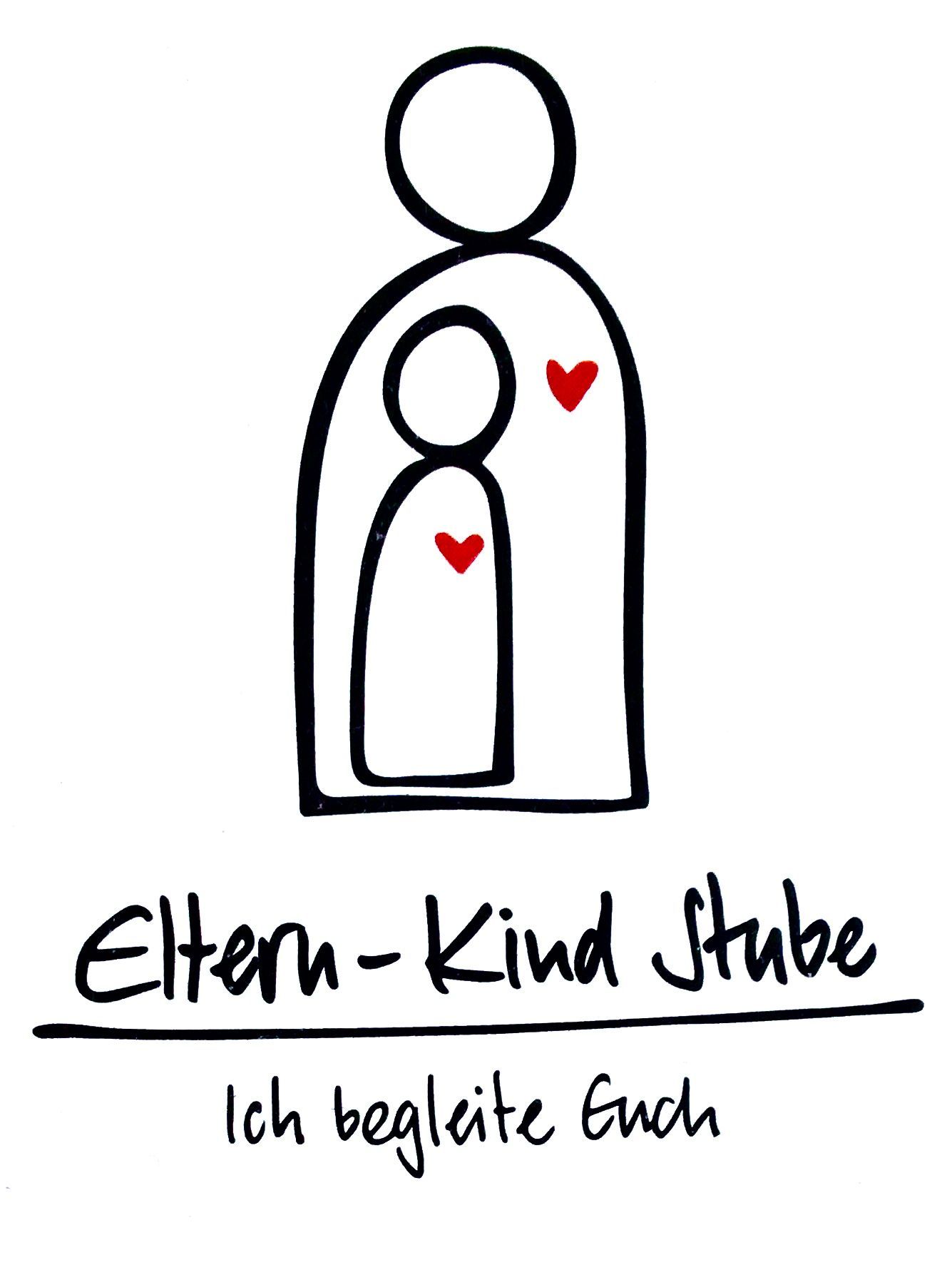Pädagogische Grundhaltung
Eltern zu sein ist von Anfang an eine der grössten Herausforderungen unserer Zeit- und gleichzeitig eine der wichtigsten Aufgaben, denn die Art und Weise, in der wir Kinder heute begegnen, wirkt sich entscheidend darauf aus, wie sie der Welt von Morgen gewachsen sein werden- und wie diese Welt aussehen wird.
Kinder können Glück, grosse Freude und inneren Reichtum in unser Leben bringen, gleichzeitig werden wir innerlich und äusserlich in einem Mass gefordert, wie dies sonst selten der Fall ist. Vor allem, wenn wir die Einzigartigkeit, Integrität und innere Lebendigkeit unserer Kinder bewahren und zu ihnen eine harmonische, auf gegenseitigem Respekt beruhende Beziehung aufbauen wollen, stehen wir ständig vor neuen Fragen, Herausforderungen und Rätseln. Jedes Kind, jede Mutter, jeder Vater, jede Situation ist anders und so werden Patentrezepte und wohl gemeinte Ratschläge in den seltensten Fällen wirklich weiterhelfen. Wir gehen ständig in Neuland und stossen dabei immer wieder an unsere Grenzen.
Emmi Pikler gibt uns hierfür eine Methode an die Hand, wo wir diesen Spagat schaffen können und unsere Wunsch, das Beste dem Kind mit zugeben, erreichbar wird. Emmi Pikler gibt Orientierung ohne unsere Intuition einschränken zu wollen. Wenn du dich mit den grundlegenden Gedanken und Prinzipien von Emmi Pikler vertraut machst, kann das deine schwierige Aufgabe als Eltern viel leichter machen. Der Ansatz ist überraschen einfach und entspringt gesundem Menschenverstand.
Die zwei Grundpfeiler der Arbeit von Dr. Emmi Pikler
Zentral an der Arbeit nach Emmi Pikler sind folgende zwei Grundpfeiler bzw. Themenbereiche:
Die selbständige Bewegungsentwicklung des Säuglings... und die
Die Einheit von Pflege und Erziehung
Selbständige Bewegungsentwicklung
Emmi Pikler hat erkannt und durch beobachtende wissenschaftliche Forschung x- Fach belegt.
- Dass sich ein Säugling in den 1-2 Lebensjahren selbständig vom Liegen auf dem Rücken über weitgehend gleiche Abläufe zum selbständigen Stehen und Gehen entwickelt.
- Dass dies ohne wesentliche Hilfe in Form von Üben und spezieller Förderung, quasi aus dem Kind selber heraus, so geschieht (gemäss einem angelegten Entwicklungsplans)
- Dass diese Bewegungsentwicklung die zentrale und umfassende Lernerfahrung dieser Lebensphase ist, welche gleichzeitig das kleinkindliche Gehirn stimuliert. (Lernprozesse führen zu unzähligen Verknüpfungen im Gehirn)
- Durch Freude an der selbständigen Arbeit und die gemachte Erfahrungen wird die Persönlichkeit des Kindes wesentlich geprägt. (kognitiv, emotional, sozial)
Welche Schlüsse zieht E. Pikler aus dieser Erkenntnis- und wie fliessen diese in ihrer praktischen Arbeit ein?
- Pikler und ihre Leute haben und leben eine grosse Achtung, einen tiefen Respekt vor der Kompetenz des Säuglings: Er ist von Anfang an als eigenständiger Subjekt Partner aller Kommunikationen und aller an ihm getätigten Handlungen.
- Daher ist der Umgang mit dem Säugling bzw. Kleinkind sehr bewusst: Insbesondere werden jegliche unnötigen Eingriffe in die Selbständigkeit des Kindes Vermieden, da sie leicht den Charakter von Übergriffen haben. Zum Beispiel: Das Kind wird grundsätzlich in keine Lage gebracht, die es aus eigenem Antrieb nicht einnehmen kann (Bauchlage, Sitzen, Stehen,…).
- Das Kind braucht ungestörte Zeit und eine vorbereitete Umgebung, um seine selbständige Aktivität entfalten zu können. Das heisst, die Umgebung des Kindes muss altersgerecht so gestaltet sein, dass sie den Säugling in seinem altersgemässen Ausprobieren und den jeweiligen Möglichkeiten unterstützt (einfache, anregende Spielsachen; Gestaltung aller „Kinderörtlichkeiten“ zwischen den Polen Freiraum und Schutz).
- Der Erwachsene sucht bei allem was er mit dem Kind tut, seine Kooperation. Man bezieht das Kind und seine spontanen Bewegungen, z.B. von Anfang an in alle Pflegehandlungen ein. Dazu gehört auch, dass man dem Kind immer erklärt, was man mit ihm tut- und ihm laufend redend spiegelt, was man an ihm wahrnimmt (z.B. „du schaust noch ein wenig skeptisch, gefällt dir das nicht? Vielleicht geht es so für dich besser…?).
„Wesentlich ist, dass das Kind möglichst viele Dinge selbst entdeckt. Wenn wir ihm bei der Lösung aller Aufgaben behilflich sind, berauben wir es gerade dessen, was für seine geistige Entwicklung das Wichtigste ist. Ein Kind, das durch selbständige Experimente etwas erreicht, erwirbt ein ganz andersartiges Wissen als eines, dem die Lösung fertig geboten wird.“
(Emmi Pikler)
Einheit von Pflege und Erziehung
Was braucht der Säugling, um die Aufgabe der ersten Lebensjahre, die selbständige Bewegungsentwicklung, bewältigen zu können?
- Es braucht eine verlässliche, konstante, tragende und zugewandte- eine „privilegierte“- Beziehung zu einem Erwachsenen ( bzw. einer überschaubaren Zahl von Erwachsenen).
- Diese intensive Beziehung bietet die emotionale Unterstützung, um die komplexe Entwicklungsaufgaben mit ihren vielfältigen Frustrationen bewältigen zu können; sie ist quasi der emotionale Nährboden, auf dem sich der innere Entwicklungsplan des Kindes entfalten kann.
Wie kann man eine solche Beziehung aufbauen?
- Hier setzt E.Pikler neue, bedenkenswerte Akzente- und zwar auf der oben skizzierten achtsamen und respektvollen Handlungen gegenüber dem Kind: Sie geht davon aus, dass im Säuglingsalter Pflegehandlungen (Füttern, Waschen/ Baden, Wickeln, An- Auskleiden,…) ohnehin einen grossen Teil der Wach-Zeit einnehmen.
- Diese Zeiträume bieten sich daher an, um als Medium, als intensive Kontakt- Zeiten zwischen dem Kind und der Bezugsperson genutzt zu werden, in denen eine privilegierte Beziehung aufgebaut werden kann.
- Es braucht nach Pikler daher keine zusätzliche „Angebote“ für den Beziehungsaufbau bzw. für die „Erziehung“ des Kindes. Vielmehr vollzieht sich der Alltag des Säuglings/ Kleinkindes bei Pikler zwischen den beiden Polen, selbständige Aktivität (Zeit, in der der Säugling mit sich selbst beschäftigt ist) und der Pflege (intensive Kontakt- Zeit).
- Dieser Ansatz wird mit dem Begriff „Einheit von Pflege und Erziehung“ beschrieben.
Wenn die Pflegezeit also die Zentralen „Gefässe“ für den Beziehungsaufbau sind, wie müssen sie dann gestaltet sein, um ihre Aufgabe erfüllen zu können?
Grundsätzlich sind die Pflege- Zeiten sehr sorgfältig gestaltet, bei Pikler ist nichts dem Zufall überlassen. Beim Lesen der Bücher, beim Sehen der Filmdockumente kann man nur ahnen, wie weit- bzw. tiefgehend der anfänglich ganz einfach anmutende Ansatz ist. Einige Aspekte davon sind:
- Ungestöhrtheit: Wenn die Bezugsperson mit dem Kind in die zweier- Situation der Pflege eintritt, ist dafür gesorgt, dass diese Kontaktzeit nicht gestört wird. Alles ist vorbereitet (Nahrung, Bad, Kleider,…) Es gibt keine Unterbrüche durch beispielsweise ein läutendes Telefon. Auch ist dafür gesorgt, dass das Kind nicht abgelenkt wird.
- Die Sprache der Hände: Im Zentrum aller Pflegehandlungen steht die Berührung des Kindes durch den Erwachsenen. In den Händen, in der Art, wie das Kind angefasst wird, spiegelt sich die Haltung des Erwachsenen zum Kind (Objekt oder Subjekt derPflegehandlungen) sowie die Befindlichkeit/ Verfassung der „Pflegeperson“. Eine Schulung im Pikler- Ansatz ist daher immer auch eine Schulung in Selbst- und Fremdwahrnehmung- und somit letztlich eine Persönlichkeitsschulung, die von vielen Faktoren beeinflusst werden und sicher einen längeren Prozess beinhalten.
- Die Sprache des Säuglings verstehen lernen, sich vom Säugling den Weg zeigen lassen: Der Säugling „Spricht“ mit dem ganzen Körper; er zeigt seine Gefühle mit seiner Mimik, seiner Körperspannung,… Das Abenteuer, diese jeweils individuelle Sprache eines jeden Kindes verstehen zu lernen, ist eine intensive Wahrnehmungs- und Beobachtungsschule. Die Bezugsperson reagiert auf die Signale des Säuglings verbal mit Inhalt (spiegeln des Wahrgenommenen) und entsprechender Tonlage sowie mit ihren Händen (Beruhigung, Entspannung,..). So entsteht eine Interaktion, ein intensiver Dialog mit dem Säugling.
- Ein grosses Anliegen von Pikler ist es, den Säugling zur Kooperation zu bringen. Mit immer gleichen Worten wird ihm von Anfang an mit Augenkontakt und liebevollem Tonfall erklärt, was mit ihm gescheit, so dass er sich in der Pflegesituation mehr und mehr vertraut fühlt. Dann bittet man das Kind bei der Pflege mitzuhelfen („gibst du mir bitte dein Ärmchen, damit ich dir das Hemd ausziehen kann?“) Auch diese ist eine Konsequenz der Haltung, dass der Säugling das kompetente „Subjekt“ der Pflege ist.
- Auch bei der Pflege z.B. beim Füttern, wird der Säugling so wenig als möglich in Haltungen gebracht, die er von sich aus nicht einnehmen kann. Auch bei der Ernährung, beim Übergang von flüssiger über breiige zu fester Nahrung, wird sehr darauf geachtet, ob der Säugling schon zum jeweiligen nächsten Schritt bereit ist.
Nach dem Kontakt „Bad“ der Pflege beginnt die Eigenzeit, die Zeit der selbständigen Aktivität des Säuglings (sofern er nicht schläft).
„Die Art, wie der Erwachsene das Kind anfasst, beeinflusst sein allgemeines Wohlbefinden und vermittelt ihm viele Botschaften“. (Anna Tardos)
„Wenn wir uns bewusst Machen, was ein Kind in seinen ersten Lebensjahren alles lernt, ohne dass es dafür formalen Unterricht erhält, können wir nur Staunen.“ (Anna Tardos)
Grundlagen zusammengefasst
- Das Grundlegende Vertrauen in die Fähigkeit des Kindes, selbst Dinge zu beginnen, zu erforschen und selbständig zu lernen.
- Eine Umgebung, die für das Kind sicher, kognitiv herausfordernd und emotional nährend ist.
- Zeit für ununterbrochenes Spielen.
- Freiheit zu erforschen und Kontakt zu anderen Kleinkindern zu knüpfen.
- Miteinbeziehen des Kindes in alle Pflegeaktivitäten als aktiver Teilnehmer und nicht als passiver Empfänger.
- Einfühlsame Beobachtung des Kindes, um seine Bedürfnisse zu verstehen.
- Beständigkeit, klar definierte Grenzen und Erwartungen, damit Selbstdisziplin/ Selbstkontrolle entwickelt werden kann.
Literatur: E- Pikler, „Lass mir Zeit“, „ Miteinander Vertraut werden“, Anna Tardos, „ Aktives Leben- die Aktivität des Kindes von 2.- 36. Monaten, Lienhart Valentin, „Vorbereitete Umgebung“, M.David und G. Appell, „Lozey- mütterliche Betreuung ohne Mutter“, Magda Gerber, „Dein Baby zeigt dir den Weg“.